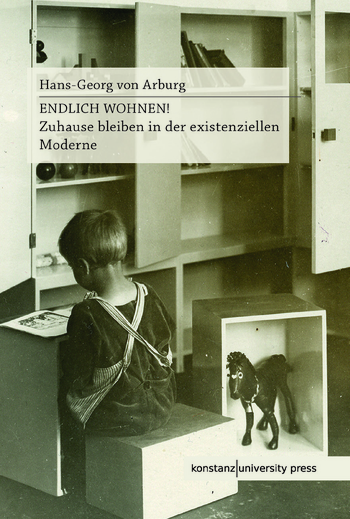
Hans-Georg von Arburg rekonstruiert den modernen Wohndiskurs in Architekturbüchern, Wohnzeitschriften, im Feuilleton der Tagespresse, in Werbefilmen und Publikumsausstellungen und untersucht dabei den vielseitigen Einsatz der Literatur, die das Thema promotet, kommentiert, reflektiert und kritisiert. Die heftig diskutierte »Wohnungsfrage« bleibt in der deutschsprachigen Öffentlichkeit von der Gründerzeit nach 1880 bis zur großen Depression um 1930 ein Dauerthema. Führende Akteure aus Architektur, Stadtplanung, Hygiene und Sozialpolitik machen immer wieder neue »ultimative« Lösungsvorschläge und lassen sich von wortgewandten Literaturproduzenten und bildmächtigen Medienschaffenden unterstützen. Die Frage, wie man in der unbehausten Moderne zuhause bleiben kann, provoziert existenzielle Narrative und kultiviert eschatologische Bildwelten. Von der lauten Propaganda für ein Neues Wohnen und dem oft leisen Protest dagegen handelt dieses Buch. Es beobachtet das Durcheinander von Wohnprogrammen und Alltagspraktiken an exemplarischen Szenen auf verschiedenen medialen Bühnen.
Zehn Kapitel stellen das typisch moderne Residieren, Haushalten, Mieten, Siedeln, Logieren, Hausen, Campieren, Fahren, Spielen und Bleiben vor. Sie führen schon im frühen 20. Jahrhundert den erstaunlichen Zusammenhang von Neuem Wohnen und moderner Friedhofsreform vor Augen, der hundert Jahre später in die provokative Frage mündet, mit der IKEA die Bewohner dieser Welt ins 21. Jahrhundert schickt: »Wohnst du noch oder lebst du schon?«